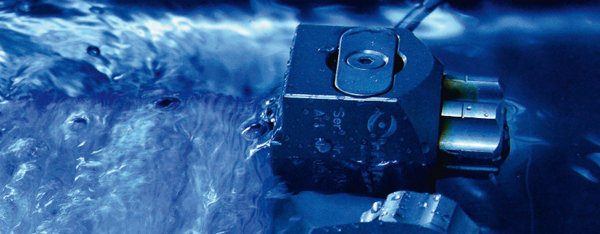
Zuckerketten aus dem Automaten
Beim Stichwort Zucker denken die meisten Menschen in erster Linie an Süßigkeiten. Manche vielleicht auch an Diabetes. Peter Seeberger vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Golm dagegen will mithilfe von Zuckern wirksamere Medikamente und Impfstoffe entwickeln. Davon sollen vor allem ärmere Länder profitieren.
Seit 2009 leitet Peter Seeberger die Abteilung Biomolekulare Systeme am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in der Nähe Potsdams. Er ist einer der Protagonisten auf dem Gebiet der Glykomforschung – einer Forschungsrichtung also, welche die Gesamtheit aller natürlichen Zuckermoleküle ergründen will. Von diesen in der Fachsprache auch Glykane genannten Molekülen will der Forscher zum Beispiel lernen, wie Zellen miteinander kommunizieren.
Chemisch gesehen, sind Zucker Verbindungen, die aus mehr oder weniger langen, verzweigten oder unverzweigten Ketten einzelner Zuckerbausteine bestehen. 80 Prozent der pflanzlichen Biomasse auf der Erde sind aus Zucker. Den weitaus größten Anteil daran stellt die Zellulose der pflanzlichen Zellwand, ein Kettenmolekül aus Glukose. Glykane verleihen aber nicht nur Pflanzenzellen Stabilität, sie sind auch die molekularen Antennen, mit denen Zellen zu Proteinen ihrer „Nachbarn“ Kontakt aufnehmen können. Jede Zelle von Mensch, Tier und Pflanze ist auf ihrer Oberfläche mit Zuckern regelrecht übersät. Wie winzige Fühler stehen die an Fette und Proteine gekoppelten Zuckerketten von der Zelloberfläche ab. Auch Bakterien und Viren nutzen solche Antennen und docken daran an.
GLYKANE ALS ADRESSCODE
Bereits bei der Befruchtung der Eizelle mischen Zucker mit. Im frühen Embryo fungieren Glykane dann als eine Art Postleitzahl und dirigieren Zellen an ihren Bestimmungsort. „Interessanterweise tauchen genau diese Zucker im späteren Leben wieder auf“, erzählt Seeberger. „Wenn Krebszellen wandern und Metastasen bilden, kommt das Adresssystem erneut zum Einsatz.“
Es gibt vier Klassen von Glykanen. Zunächst die Glykoproteine, also Proteine, an die Zuckerketten gebunden sind. 75 Prozent der Membranproteine menschlicher Zellen gehören dazu. Ein berühmtberüchtigtes Beispiel ist Erythropoetin, kurz EPO. Der Botenstoff regt das Wachstum roter Blutkörperchen an und hilft so Krebspatienten mit gestörter Blutbildung, aber auch Sportlern bei verbotener Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit. Zur zweiten Klasse, den Glykosaminoglykanen, zählt etwa das Heparin, ein in der Medizin ständig genutzter Hemmstoff der Blutgerinnung. Während seine Glykankette aus 200 bis 250 Zuckern besteht, ist der süße Teil der dritten Klasse, der Glykolipide, meistens nur fünf bis sechs Zucker lang. Auf solch zuckerhaltigen Fetten beruhen etwa die verschiedenen Blutgruppen. Die vierte Gruppe sind Verbindungen aus Fetten und Proteinen mit Glykanen, „GPI-Anker“. Sie befestigen Proteine in der Zellmembran. Im Vergleich zu anderen Molekülen sind Glykane relativ einfach aufgebaut.

Schon Ende des 19. Jahrhunderts entschlüsselte der deutsche Chemiker Emil Fischer die Struktur einzelner Zuckerbausteine und erhielt dafür 1902 den Nobelpreis. Warum hat es also so lange gedauert, die Funktion der Glykane zu erforschen? „Das ist leicht erklärt“, sagt Seeberger, „es gab bis vor Kurzem keine schnelle und verlässliche Technik, mit der wir Zuckerketten analysieren und künstlich herstellen konnten.“ Das Rückgrat der Glykane bilden ringförmige Zuckerbausteine aus jeweils vier oder fünf Kohlenstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Solche Ringe besitzen viele Verknüpfungspunkte. Ihre biologische Aktivität hängt davon ab, ob zwei Zucker an der richtigen Stelle und räumlich korrekt zusammengefügt werden. Wie viele unterschiedliche Glykane es überhaupt gibt, weiß niemand. Auch darüber, ob bestimmte Längen oder Muster immer wieder vorkommen, gibt es noch viele Vermutungen.
Während Wissenschaftler DNA bereits in den 1970er-Jahren vervielfältigen konnten, gelang die automatische Synthese von Mehrfachzuckern erst 2001. Peter Seeberger, der damals am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge forschte, baute dafür einen alten DNA-Syntheseautomaten um. Das Verketten der Zuckerbausteine funktioniert nämlich ähnlich wie das Aneinanderfügen der DNA-Bausteine. An ein Trägermaterial aus sandkorngroßen Kunststoffkügelchen werden Verbindungsmoleküle gebunden, die wie kleine Ösen funktionieren. An diese wird der erste Zucker geheftet. Seine potenziellen Bindungsstellen sind mit Schutzmolekülen versehen, die abgespalten werden können. Im nächsten Schritt wird die Schutzkappe an der vorgesehenen Stelle entfernt. Dann folgt der nächste Kupplungsschritt.
Anheften, Schutzkappe entfernen, anheften, Schutzkappe entfernen – Zyklus um Zyklus gelang es ihm, einen Zucker an den anderen zu fügen bis zu einem „Neuner“, also einem Mehrfachzucker aus neun Zuckerbausteinen. Mit dem Syntheseautomaten verkürzte sich die Arbeitszeit von Monaten auf Stunden. Seither hat das Team die Methode weiter verfeinert und mehr als fünfzig unterschiedliche Zuckerbausteine für die Maschine hergestellt. Jeder Zyklus, jedes neue Kettenglied, dauert rund drei Stunden. Mit Ketten aus dreißig Zuckerbausteinen halten die Forscher derzeit den Weltrekord.

Ein kritischer Punkt waren die Verbindungsmoleküle, denn am Schluss müssen die Glykane ja von dem Trägerkunststoff abgespalten werden. Die neueste Version ist nun ein lichtempfindliches Molekül. Dabei gab es nur einen Haken: Licht kann in den Kunststoff nicht eindringen. Doch dieses Problem hatte Mitarbeiter Daniel Kopetzki bereits in einem anderen Forschungsprojekt gelöst. Bei der Synthese des Malariawirkstoffs Artemisinin. Damit das Licht wirklich alle Moleküle erreicht, umwickelte Kopetzki ein mit sechzig LEDs gespicktes, durchsichtiges Kunststoffbrettchen mit einem dünnen, transparenten Schlauch und pumpte die Reaktionslösung hinein. Über Lichtstärke und Pumpgeschwindigkeit ließ sich die Reaktion nun optimal steuern – die „Durchflusssynthese“ war geboren. „Auf diese Weise können wir die Ausbeute an chemischen Reaktionen unabhängig machen von dem menschlichen Faktor, also dem Geschick des Chemikers“, betont Seeberger.
Der Durchmesser des Schlauchs, durch den die Zucker gepumpt werden, ist kaum größer als die Trägerpartikel. So bekommt tatsächlich jedes Verbindungsmolekül ausreichend Licht und kann die an den Träger gehefteten Zuckerketten freigeben.
IMPFSTOFFE AUS ZUCKER
Sechs Zucker-Syntheseautomaten gibt es bisher weltweit, vier davon stehen in Berlin. Seebergers Team setzt sie, zusammen mit den Durchflussapparaturen, für unterschiedliche Zwecke ein. Zu den 75 Mitarbeitern gehören neben Chemikern, Biochemikern und Ingenieuren auch Immunologen und Parasitologen, denn ein Schwerpunkt von Seebergers Forschung sind Impfstoffe aus Glykanen.

Drei auf Zuckern basierende Impfstoffe gegen bakterielle Infektionen sind bereits mit traditionellen Methoden entwickelt worden: gegen Lungenentzündung (Pneumokokken), Hirnhautentzündung (Meningokokken) und Haemophilus influenzae Typ b. Kinder in Deutschland werden heute routinemäßig gegen alle drei Erreger geimpft. Bisher werden die Glykane von gezüchteten Bakterien erzeugt, das macht die Herstellung kompliziert und in vielen Fällen unmöglich. Seeberger möchte die Impfstoffe künftig komplett chemisch herstellen. Damit lassen sich neue Impfstoffe auch gegen Bakterien herstellen, die nicht gezüchtet oder deren Zucker nicht isoliert werden können.

Sein Plan: Man stelle ein Glykan von der Oberfläche des Erregers künstlich her und verabreiche es Versuchstieren, deren Immunsystem daraufhin Antikörper dagegen bildet. Ein reiner Zuckerimpfstoff funktioniert jedoch nicht, weil ihn das Immunsystem von Kindern unter zwei Jahren und Menschen über 55 nicht als fremd erkennt.

Ein Hilfsstoff, ein Adjuvans, ist nötig, um das Immunsystem anzustacheln. Körperfremde Trägerproteine wie das Diphtherie- oder Tetanustoxin werden dazu bisher eingesetzt. Doch die lösen nicht nur vereinzelt starke Impfreaktionen aus, sondern sind mitverantwortlich für den hohen Preis. Denn Proteine sind wärmeempfindlich. „Mehr als die Hälfte der Impfkosten verschlingt die Kühlkette. In Afrika und Asien ist das ein Riesenproblem.“ Koppelt man das Glykan stattdessen an ein bestimmtes Fettmolekül, sind beide Probleme auf einmal gelöst. Ein Adjuvans ist dann überflüssig, und weder Fett noch der Zucker sind wärmeempfindlich. Glykolipide sind deshalb die derzeit heißesten Kandidaten für vollsynthetische Impfstoffe.
Seebergers Team arbeitet an Impfungen gegen verschiedene Erkrankungen, darunter die Tropenkrankheiten Leishmaniose und Malaria sowie gegen Neisseria meningitidis – Bakterien, die vor allem in Schwellenländern Hirnhautentzündung hervorrufen. Von Neisseria gibt es vier Varianten, sogenannte Serotypen, und für jede Variante existiert ein eigener Impfstoff. Das Problem: Serotyp B enthält ein Glykan, das auch im Gehirn vorkommt. Eine Impfung gegen diesen Zucker könnte eine Autoimmunkrankheit auslösen. Ein Impfstoff gegen einen Teil davon – das sogenannte Endotoxin Lipid A – aber vielleicht nicht. Seebergers Team synthetisierte die Viererzuckeroben kette dafür im Labor. Und tatsächlich: Versuchstiere, die damit geimpft wurden, bildeten sogar gleich Antikörper gegen alle vier Serotypen.

EIN ERREGER, VIELE VARIANTEN
Auch Streptococcus pneumoniae lässt sich nicht leicht mit einer einzigen Impfung bekämpfen. Der Erreger ruft Mittelohrentzündungen hervor und kann sich in schweren Fällen in Gehirn oder Lunge festsetzen. Zehntausende Kinder starben früher jedes Jahr daran. Der heute verfügbare Impfstoff enthält 13 verschiedene Glykane. „Leider hat der Erreger 96 verschiedene Serotypen mit entsprechend vielen Zuckern. Der Impfstoff wirkt also nur bei einem Bruchteil der Infektionen“, erklärt Seeberger. „Seit zwei Jahren beschäftigen sich zehn Mitarbeiter intensiv mit diesem Erreger und lernen sehr viel dabei: Manche Zuckerbausteine sind essenziell, andere kann man weglassen.“
Tests für die Krankheitsdiagnostik sind ein weiteres Forschungsfeld von Seeberger. Sie reagieren auf Antikörper des Immunsystems gegen Bakterien oder Viren. So haben die Forscher beispielsweise ein Nachweisverfahren für Infektionen mit dem Parasiten Toxoplasma gondii entwickelt. Dieser von Katzen übertragene Parasit ist in der Bevölkerung weit verbreitet, aber nur für schwangere Frauen sowie für Menschen mit schwachem Immunsystem, etwa infolge einer Krebstherapie, gefährlich. Mit Glykantests lässt sich nicht nur bestimmen, ob ein Mensch mit einem bestimmten Keim infiziert ist, sondern auch, ob er jemals Kontakt damit hatte. Auch mit solchen, die als Waffe eingesetzt werden können. Und so hat die Gruppe auch Diagnoseverfahren für potenzielle Biowaffen wie Milzbrand und den Pesterreger Yersinia pestis entwickelt.
Bis zu 10 000 unterschiedliche Zucker, jeder einzelne verknüpft mit einem fluoreszierenden Protein, passen auf kleine Glaschips. „Mit einem Milligramm Glykan können wir Tausende Chips bestücken“, erzählt Seeberger. Er hat die Zucker als Erster mit einem umgebauten Tintenstrahldrucker auf die Plättchen gedruckt. Der Test selber ist dann ganz einfach: einen Tropfen Blut darüber, abwaschen und anfärben – das war’s schon. Antikörper in der Blutprobe binden nun an die passenden Zuckermoleküle und werden durch fluoreszierende Proteine zum Leuchten gebracht. Das Muster aus Lichtpunkten verrät schließlich den Antikörper und damit den Erreger.
Andere Tests sollen gesunde Zellen von Krebszellen unterscheiden. Daniel Kolarich aus Peter Seebergers Gruppe hat herausgefunden, dass gesunde Hautzellen andere Glykane auf ihrer Oberfläche tragen als Tumorzellen. Er arbeitet nun zusammen mit Leipziger Dermatologen an einem Test auf bösartige Hautkrebszellen. Mit Seebergers inzwischen mehr als 600 verschiedene Glykane umfassender Zuckerbibliothek arbeiten Forscher weltweit: So verringern Züricher Neurologen mit Glykanen die Auswirkungen von Schlaganfällen, und Mediziner der Charité spüren mit radioaktiv markierten Zuckern Krebszellen auf.
Das Interesse der Pharmaindustrie an der Glykomik war anfänglich gering, wie Seeberger erfahren musste, als er an der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Malaria arbeitete. 2002 gelang der Nachweis, dass ein Glykan ein lange gesuchtes Toxin des Malariaerregers ist. „Als wir es daraufhin nachgebaut und Mäuse damit geimpft haben, überlebten drei von vier Mäusen eine anschließende Malariainfektion.“
Die Wirksamkeit des weiter verbesserten Impfstoffkandidaten konnte im Tierversuch auf nahezu 100 Prozent gesteigert werden. Auch die Technik, den Impfstoff in großen Mengen zu produzieren, stand bereit. Seit 2007 liegt der Impfstoff auf Eis, weil den beteiligten Firmen das Risiko zu hoch war, die immensen Entwicklungskosten wieder zu erwirtschaften. „Die Industrie fördert eben vorrangig Projekte zu Krankheiten, die in den Industrienationen auftreten, denn damit ist später gutes Geld zu verdienen. Von Patienten aus ärmeren Ländern ist dagegen kaum Profit zu erwarten“, sagt Seeberger.
Dabei wird ein Malariaimpfstoff doch so dringend gebraucht. Erst kürzlich musste der von GlaxoSmithKline entwickelte und mit mehreren Hundert Millionen Euro von der Bill & Melinda Gates Foundation geförderte Impfstoffkandidat aufgegeben werden. Der Impfstoff hatte sich nach Jahren der Entwicklung als nicht genügend wirksam herausgestellt.
Die Konsequenz: Jede Minute stirbt auf der Welt ein Kind an Malaria. Dabei wären nur 4,5 Kilogramm Glykan für die Impfung der 65 Millionen Kinder nötig, die jedes Jahr in Malariagebieten geboren werden, hat Seeberger ausgerechnet. „Eine Impfung würde pro Kind nur wenige Cent kosten.“ Aufgegeben hat er den Impfstoff trotz allem nicht, sondern er wirbt um neue Gelder, um diesen weiterzuentwickeln. Als Gutmensch oder Weltverbesserer sieht Peter Seeberger sich nicht. Eher als Werkzeugmacher. „Wenn wir das Wissen und die Technologie haben, um etwas zu verändern, sollten wir es tun.“ Selber klinische Studien zu betreiben ist aber weder finanzierbar noch mit dem Auftrag der Max-Planck-Gesellschaft zu vereinen. Forschungsresultate möglichst nah an den Markt zu bringen aber schon.
Auch einige Firmen sind aus der Forschung in Seebergers Abteilung bereits hervorgegangen. Darunter eine mit Namen GlycoUniverse. Weckt der Name nicht übergroße Erwartungen? Peter Seeberger lacht. „Nein, denn die Firma produziert die Zucker als Werkzeuge, die künftig bei vielen Anwendungen unverzichtbar sein werden.“ Süße Hoffnungen also auf eine bessere Medizin für Menschen in allen Welten.
CATARINA PIETSCHMANN





